Parkinson: Wie man abgestorbene Neurone ersetzt
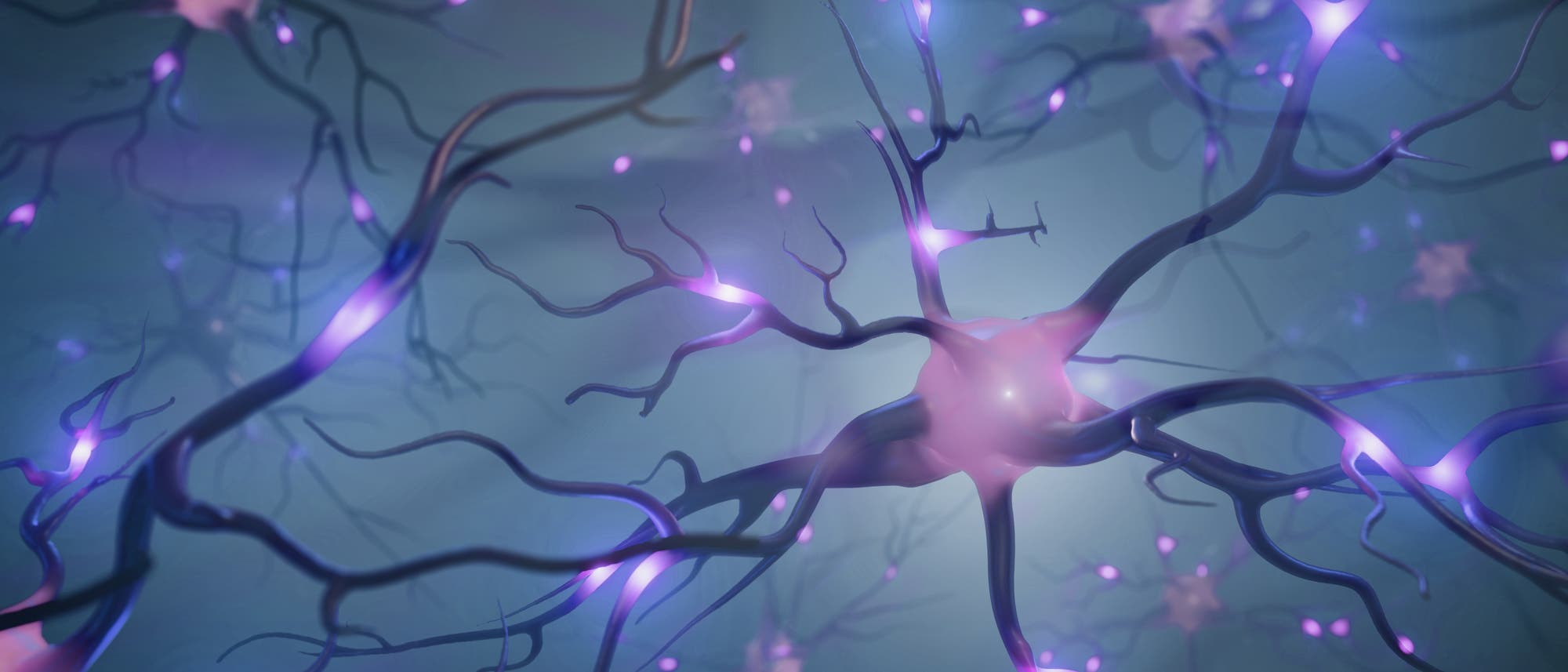
Bei der Parkinsonkrankheit sterben nach und nach jene Nervenzellen im Gehirn ab, die den Botenstoff Dopamin herstellen. Diesen brauchen wir, um unsere Bewegungen zu steuern. Daher gehören zu den typischen Symptomen der Krankheit etwa Zittern, Steifheit der Muskeln und erhebliche Bewegungseinschränkungen. Medikamente können den Dopaminmangel im Gehirn zwar teilweise ausgleichen und so die Beschwerden lindern, aufzuhalten ist das Absterben der Nervenzellen in der Substantia nigra bisher jedoch nicht. Vielleicht kann man aber neue züchten.
Genau das ist nun einem Forscherteam um den Molekularmediziner Xiang-Dong Fu von der University of California in San Diego gelungen – zumindest bei Mäusen. Indem die Wissenschaftler ein bestimmtes Protein in Astrozyten (einer bestimmten Klasse von Zellen im zentralen Nervensystem) ausschalteten, konnten sie diese zu Dopamin produzierenden Nervenzellen umprogrammieren. Mit dieser Strategie ließen sich womöglich Parkinson und andere Krankheiten behandeln, bei denen Nervenzellen zu Grunde gehen, schreiben die Forscher in der Fachzeitschrift »Nature«.
Astrozyten und Neurone haben die gleichen Vorfahren
Im Wesentlichen besteht unser Gehirn aus zwei Zelltypen: den Neuronen, die elektrische Impulse weiterleiten können, und den Gliazellen, die das nicht können. Astrozyten zählen zu den Gliazellen; sie lassen sich von anderen Gliazellen auf Grund ihrer ausgeprägten Zellfortsätze abgrenzen. Von dieser sternförmigen Gestalt leitet sich auch ihr Name ab: »Aster« steht im Griechischen für »Stern«. Bis in die 1980er Jahre war die Wissenschaftsgemeinde davon ausgegangen, dass Gliazellen lediglich eine Art Stützgewebe für die Nervenzellen darstellen. Dieses Bild hat sich seitdem jedoch gewandelt; insbesondere als die Neurobiologin Magdalena Götz vom Helmholtz Zentrum München um die Jahrtausendwende herausfand, dass bestimmte Gliazellen – die radialen Gliazellen – Stammzelleigenschaften haben und sich zu verschiedenen Zelltypen entwickeln können, darunter Neurone und Astrozyten.
Sobald sich Zellen spezialisieren, werden in ihrem Erbgut bestimmte Gene an- und andere ausgeschaltet. Dabei spielt unter anderem ein Protein namens PTB eine Rolle. Bereits vor einigen Jahren hat sich das Team um Fu gefragt, was geschieht, wenn man die Produktion von PTB in Zellen – damals aus dem Bindegewebe – verhindert. Dies erreicht man zum Beispiel mit Hilfe kleiner RNA-Moleküle, die zielgerichtet diejenigen Gene abschalten können, die für die Herstellung des Proteins verantwortlich sind. Fachleute bezeichnen diesen Vorgang als RNA-Interferenz.
Als die Forscher das Protein PTB auf diese Art und Weise stilllegten, waren sie überrascht: Nach einigen Wochen waren die Kulturschalen anstatt von Bindegewebs- von Nervenzellen bevölkert. Um herauszufinden, ob das auch bei Zellen aus dem Gehirn funktioniert, verpackte das Team um Fu gegen PTB gerichtete RNA in ein Virus und gab dieses zu den Astrozyten von Mäusen. Nach vier Wochen hatten sich 50 bis 80 Prozent der Zellen, die das Virus – und damit die RNA – in sich aufgenommen hatten, in Neurone verwandelt. Das machte sich sowohl an ihrem Aussehen als auch an den Genen bemerkbar, die nun in ihrem Inneren abgelesen wurden: Die Zellen stellten nicht mehr die astrozytentypischen Proteine her, sondern jene, die Nervenzellen brauchen. Außerdem waren die Zellen von da an fähig, elektrische Impulse weiterzuleiten.
Die Forscher wollten wissen, ob die Umprogrammierung nicht nur in der Kulturschale, sondern auch im Gehirn funktioniert. Dazu spritzten sie das Virus direkt in die Substantia nigra von lebendigen Mäusen. Und tatsächlich: Zehn Wochen nach der Injektion hatten sich 80 Prozent der Astrozyten, die das Virus aufgenommen hatten, in Neurone verwandelt. Bestimmte Enzyme, die die Zellen nun herstellten, wiesen darauf hin, dass sie Dopamin herstellen, speichern und abgeben konnten.
Ob dem tatsächlich so ist, überprüften die Forscher an Mäusen mit parkinsonähnlichen Symptomen. Diese rührten daher, dass die meisten ihrer Dopamin produzierenden Neurone auf Grund einer Behandlung mit einer speziellen Chemikalie abgestorben waren. Die Konzentration des Dopamins war bei den Tieren auf 25 Prozent des normalen Werts gesunken. Mit Hilfe des PTB stilllegenden Virus konnten die Forscher das Dopaminlevel im Gehirn der Tiere auf mehr als das Doppelte anheben. Das spiegelte sich in deren Verhalten wider: Sie bewegten sich wieder, ohne zu stocken oder zu zittern.
Nicht die ersten Neurone aus Astrozyten
Das Team um Fu ist allerdings keineswegs das erste, das Astrozyten in Neurone umgewandelt hat: Der Arbeitsgruppe um Magdalena Götz gelang das bereits im Jahr 2002. Sie hatte damals nicht PTB, sondern andere Proteine, etwa den Transkriptionsfaktor Pax6, manipuliert. Offenbar gibt es also mehrere Stellen, an denen man eingreifen kann, um Astrozyten in Neurone zu verwandeln. Die Gruppe um Götz stellte damals Nervenzellen der Großhirnrinde her, die den Botenstoff Glutamat benutzen und nicht Dopamin. Götz freut sich, dass die Forschung in diesem Bereich nun weiter voranschreitet.
Indem es mehrere Proteine in Astrozyten beeinflusste, konnte ein Team um den Neurobiologen Ernest Arenas vom Karolinska-Institut in Stockholm schon 2017 die Dopaminproduktion im Gehirn von parkinsonkranken Mäusen ankurbeln. Die neu entstandenen Nervenzellen gingen jedoch nicht die für ein gesundes Gehirn typischen Verbindungen ein. Folglich konnten die Mäuse nicht von ihren Parkinsonsymptomen befreit werden. Die »Einfachheit und Effizienz« des Ansatzes von Fu und seinen Kollegen sei sehr attraktiv, schreibt Arenas in einem begleitenden Kommentar in »Nature«.
»Dass man nur einen Schalter umlegen muss, um alles wieder heile zu machen, klingt fast zu schön, um wahr zu sein«, sagt Günter Höglinger von der Medizinischen Hochschule Hannover. Er leitet die dortige Klinik für Neurologie und arbeitet daran, die Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten für Parkinsonpatienten zu verbessern. Er ist skeptisch, ob man durch das Ausschalten eines einzelnen Proteins tatsächlich genau das erreicht, was man möchte: Dopamin produzierende Neurone. Und zwar ausschließlich in der Substantia nigra.
»Dass man nur einen Schalter umlegen muss, um alles wieder heile zu machen, klingt fast zu schön, um wahr zu sein«
Günter Höglinger, Leiter der Klinik für Neurologie der Medizinischen Hochschule Hannover
Das Team um Fu hatte den Mäusen das Virus auch in andere Hirnregionen injiziert. Dort wandelten sich zwar auch Astrozyten in Neurone um, diese stellten aber kein Dopamin her. Offenbar haben die Forscher in den Hirnzellen – je nach Umgebung – unterschiedliche Programme angeworfen. Man müsse sich nun genau anschauen, welche Gene in den umgewandelten Zellen abgelesen werden, sagt der Neurogenetiker Wolfgang Wurst vom Helmholtz Zentrum München. Er ist überrascht von den regionalen Unterschieden, die Fu und Kollegen bei den umprogrammierten Astrozyten festgestellt haben.
Denn das Protein PTB ist ein vielfältiges Werkzeug der Zellen. Über einen Vorgang, den Fachleute als RNA-»Splicing« bezeichnen, reguliert es etliche Gene. Es könnte also sein, dass man mit seiner Stilllegung auch Gene an- oder abschaltet, die nichts mit der Umprogrammierung zu Neuronen zu tun haben, aber zu Nebenwirkungen führen. Möglicherweise entstehen so neben Neuronen noch andere, unerwünschte Zelltypen. Um dies zu erfassen, müssten die Tiere mit den reprogrammierten Zellen umfassend und systematisch untersucht werden, sagt Wurst.
Insgesamt findet er die Ergebnisse des Forscherteams sehr beeindruckend. Der Neurogenetiker und seine Gruppe arbeiten an einer ähnlichen Strategie: Sie wollen Zellen in jener Hirnregion umprogrammieren, die die Signale der Dopamin produzierenden Neurone empfangen. Statt RNA-Interferenz setzen die Münchner auf die Genschere CRISPR-Cas und haben andere Gene im Blick. Wurst glaubt, dass Methoden zur Regeneration von körpereigenen Neuronen großes Potenzial zur Heilung neurodegenerativer Krankheiten haben.
Es gibt noch viele Fragezeichen
Höglinger ist weniger optimistisch. Bislang sei nicht sicher, wie lange die umprogrammierten Neurone Dopamin herstellen. Möglicherweise verblasse der Effekt auch wieder, sagt er. Er traue den Ergebnissen erst, wenn sie durch andere Arbeitsgruppen bestätigt worden seien. Zudem schlägt er vor, die Methode an einem Tiermodell zu überprüfen, das dem Verlauf der Parkinsonerkrankung beim Menschen näher kommt. »Die Krankheit ist komplex und breitetet sich auch in anderen Hirnregionen aus. Die alleinige Reparatur der Dopamin produzierenden Neurone in der Substantia nigra reicht nicht aus, um Parkinson zu heilen«, sagt der Mediziner, der der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen vorsteht.
Er verfolgt den Ansatz, das Absterben von Nervenzellen – und damit die Krankheit selbst – zu verhindern, anstatt den entstandenen Schaden hinterher zu reparieren. Das sei bislang noch nicht möglich und die wichtigste und spannendste Herausforderung der Parkinsonforschung. Mit den vorhandenen Medikamenten ließe sich der Dopaminspiegel bereits relativ gut regulieren, sagt Höglinger. Die Methode von Fu und seinem Team sei zwar wissenschaftlich sehr originell – im Grunde mache sie aber auch nichts anderes.
Daneben bleibt die Frage nach der Darreichung. Dem Patienten ein Virus ins Gehirn zu injizieren, wäre sicherlich nicht die erste Wahl. Zum einen wäre das relativ aufwändig, und zum anderen wäre das Virus dauerhaft dort – und mit ihm eventuelle Nebenwirkungen. Besser geeignet wären so genannte Antisense-Oligonukleotide: extrem kurze RNA-Stücke, die ein Protein nur zeitweilig außer Kraft setzen, weil sie im Körper wieder abgebaut werden. Man könnte sie dem Patienten im Bereich der Lendenwirbel ins Rückenmark spritzen und von dort aus ins Gehirn wandern lassen. Es gibt bereits zugelassene Medikamente, die so funktionieren: etwa Nusinersen, einen Wirkstoff zur Behandlung von genetisch bedingtem Muskelabbau.
Fus Team designte auch Oligonukleotide gegen PTB und spritzte sie den Parkinsonmäusen ins Gehirn – mit ähnlichem Ergebnis: Die Mäuse waren symptomfrei. Neurogenetiker Wurst hätte sich jedoch gewünscht, dass das Team das Verhalten der Tiere genauer untersucht hätte, um festzustellen, ob sich deren Feinmotorik ebenfalls verbessert hatte. Zudem sei unklar, ob die Umprogrammierung der Zellen und Integration in bestehende neuronale Netzwerke auch bei älteren Mäusen funktioniert. Die Tiere, die Fus Gruppe einsetzte, waren relativ jung. Bei Menschen beginnt die Parkinsonkrankheit in der Regel erst ab einem Alter von etwa 60 Jahren.
Außerdem spielen bei neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson oder Alzheimer noch weitere Faktoren wie zum Beispiel fehlgefaltete Proteine eine wichtige Rolle: Sie vergiften die Nervenzellen und führen dazu, dass diese absterben. Die Eiweißablagerungen würden höchstwahrscheinlich nach der Behandlung im Gehirn des Patienten verbleiben. Sie könnten auch die neu entstandenen Neurone schädigen, befürchtet der Biochemiker James Shorter, der an der University of Pennsylvania zu fehlgefalteten Proteinen forscht. Dennoch hält er die Studie von Fu und seinen Kollegen für äußerst spannend. »Ich glaube, der therapeutische Nutzen würde diese Sorge überwiegen.« Möglicherweise könne man die Therapie wiederholen, sofern der Abbau von Neuronen erneut zum Problem wird.

Schreiben Sie uns!