Mikrobiologie: Die »Dunkle Materie« der Mikroben
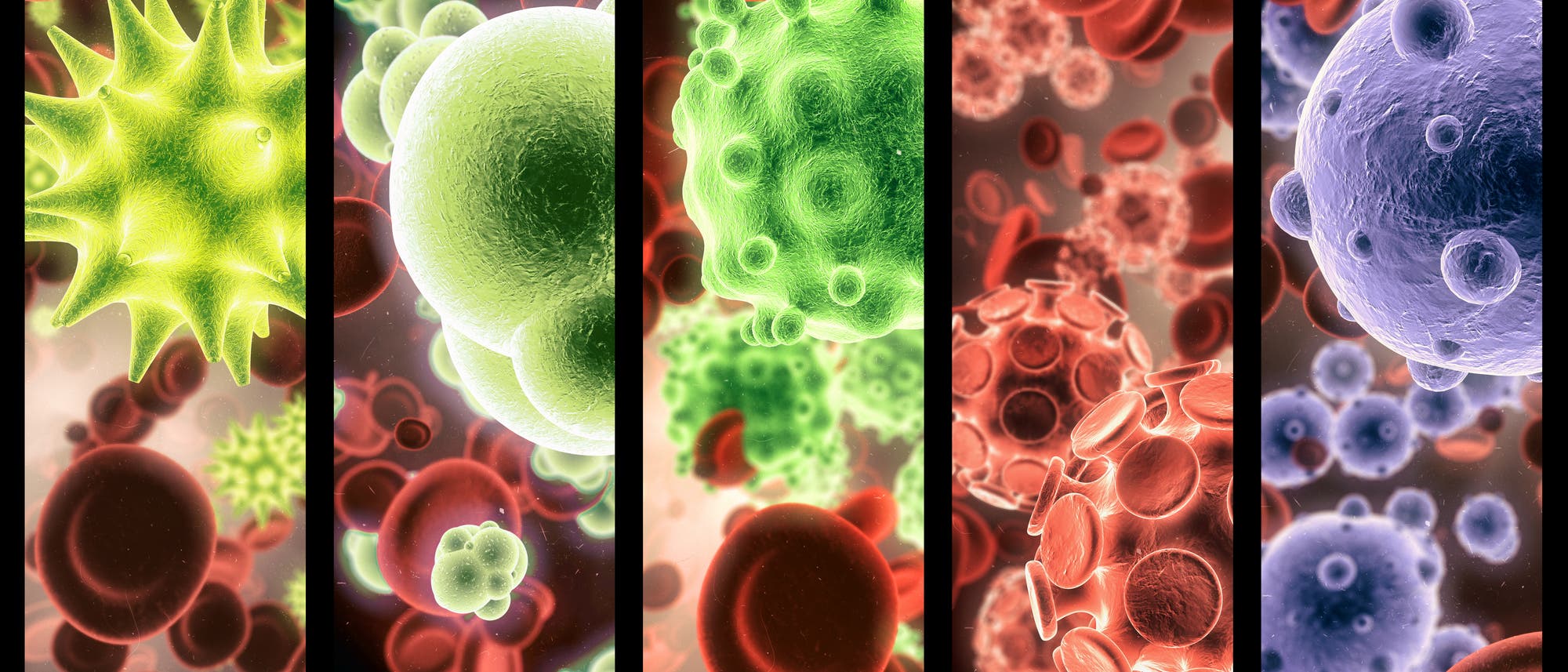
Wer im Labor von Yoichi Kamagata anfängt, in der Hoffnung, ungewöhnliche Mikroorganismen zu züchten, wird erst einmal enttäuscht: Jeder muss zunächst versuchen, Oscillospira guilliermondii zu kultivieren, ein recht gewöhnliches Bakterium, das in den Eingeweiden von Kühen und Schafen zu finden ist, aber bislang noch nicht unter Laborbedingungen gezüchtet wurde. Der Mikrobiologe Kamagata vom National Institute of Advanced Industrial Science and Technology in Tsukuba, Japan, ist seit mehr als einem Jahrzehnt von den stäbchenförmigen Mikroben fasziniert, weil sie offenbar nur in Tieren gedeihen, die sich von frischem Gras ernähren. »Bisher war noch niemand erfolgreich«, beklagt Masaru Nobu, Ingenieur und Mikrobiologe in Kamagatas Gruppe.
Oscillospira guilliermondii ist längst keine Ausnahme; die überwiegende Mehrheit der mikrobiellen Vielfalt kann nach wie vor nicht in Laboren gezüchtet werden. Diese mikrobielle »Dunkle Materie« könnte allerdings nützliche Enzyme, neue antimikrobielle Wirkstoffe und andere Therapeutika enthalten. Die moderne Metagenomik, bei der die DNA von vielen Mikroorganismen auf einmal sequenziert wird, hat zwar die Zusammensetzung etlicher mikrobieller Milieus offengelegt. Aber sie erlaubt es den Forschern weiterhin nicht, grundlegende Fragen über die enthaltenen Mikroben zu beantworten. Zum Beispiel: Was verstoffwechseln sie? Welche Metaboliten, also chemischen Verbindungen, produzieren sie? Und wie interagieren sie mit anderen Mikroben in ihrer Umgebung? Um die Antworten auf solche Fragen zu finden, müssen Mikrobiologen die Organismen im Labor zuerst isolieren und dann kultivieren.
Das kann eine heikle Angelegenheit sein: Manche Mikroben wachsen sehr langsam, manche nur in Anwesenheit bestimmter anderer Mikroorganismen, und daneben gibt es eine Vielzahl weiterer besonderer Bedürfnisse. Einige wenige Wissenschaftler verfolgen daher einen recht unspezifischen Ansatz: Sie legen massenhaft Kulturen an in der Hoffnung, dass etwas Interessantes dabei herauskommt. Die meisten versuchen jedoch, gezielt diejenigen Mikroben zu züchten, die sie besser verstehen wollen. Unabhängig von der Vorgehensweise ist dabei allerdings immer Ausdauer, Geduld – und auch ein wenig Glück – erforderlich.
Ungewöhnliche Methoden gefragt
»Es ist eine Illusion zu glauben, dass man Mikroorganismen studieren kann, ohne sie zu kultivieren«, sagt Didier Raoult, Direktor des Institut Hospitalier Universitaire IHU Méditerranée Infection in Marseille, Frankreich. Seine »Abenteuer« begannen, als er ein relativ »junges Kind« war, sagt er, als er im Jahr 1983 beschloss, Rickettsia zu untersuchen – eine Bakterienart, der nachgesagt wurde, dass sie schwierig zu isolieren und zu züchten sei. Heute überträgt sich Raoults Entdeckergeist auch auf seine Studenten – und sie greifen zu ungewöhnlichen Mitteln: Beispielsweise verrichteten manche im Labor ihr Geschäft, damit sie die Stuhlproben schnell in eine sauerstofffreie Umgebung bringen konnten. In einer solchen wachsen nämlich die besonders »interessanten« Mikroben. Diese Hingabe zur Bakterienforschung hat mindestens eine neue Art ans Licht gebracht, das Faecalibacterium timonensis – und die Kultivierung eine Reihe weiterer sauerstoffempfindlicher Mikroben ermöglicht.
Mit seiner als »Culturomics« bezeichneten Methode untersucht Raoul aber auch ganz konventionell Proben von Patienten oder anderen Freiwilligen. Culturomics ist eine robotergestützte Methode, die automatisch verschiedene Kulturbedingungen schafft und dann die gewachsenen Bakterien mittels Massenspektrometrie und ribosomaler RNA-Sequenzierung identifiziert. Raoult schätzt, dass er und seine Mitarbeiter damit bisher etwa 700 neue Organismen kultivieren konnten, hauptsächlich solche aus dem menschlichen Darm.
In der Tat sei eine der größten Herausforderungen in seinem Labor, mit der Benennung und Beschreibung der neuen Arten Schritt zu halten, sagt Raoult. Das Team wählt dabei etwa Namen, die andere Forscher ehren sollen oder die Krankheit der Person widerspiegeln, die die Stuhlprobe abgegeben hat. Beliebt sind auch Namen, die an den Standort des Instituts erinnern. Jüngst benannte die Gruppe ein stäbchenförmiges Bakterium Gordonibacter massiliensis, gemäß dem alten Namen für Marseille. Ein anderes heißt Prevotella marseillensis, nach einer in Marseille lebenden Person, die an einer Clostridium-difficile-Infektion litt.
Labor in der Natur
In der Regel versuchen Forscher wie Raoult, die Bedingungen im Labor so anzupassen, dass dort die neuen Mikroben überleben. Zu diesem Zweck kopieren sie die natürliche Umgebung der Mikroorganismen. Slava Epstein, Mikrobiologe an der Northeastern University in Boston, Massachusetts, fragt sich aber: »Warum imitieren wir? Lasst uns einfach Organismen in der Natur kultivieren.«
Epsteins Team hat dazu mehrere Geräte entwickelt, die es den Forschern ermöglichen, Reinkulturen in natürlichen Böden oder Sedimenten zu inkubieren. Eine kostengünstige Version ist der so genannte Isolationschip, kurz iChip, der im Prinzip aus einem Plastikhalter für Pipettenspitzen besteht. Die Forscher befüllen die Löcher mit einer in geschmolzenem Agar verdünnten Mikrobenprobe, in der Hoffnung, dass jede Kammer eine oder einige wenige »Startermikroben« enthält. Halbdurchlässige Polycarbonatmembranen auf beiden Seiten des Plastikhalters lassen Nährstoffe und weitere Moleküle aus der Umgebung in die Kammern, verhindern aber, dass andere Mikroben eindringen.
Üblicherweise hat das Team einen Eimer mit Erde im Labor stehen und steckt einfach nur iChips hinein, damit sich Kulturen entwickeln können. Gelegentlich deponieren sie aber auch iChips in der Natur, die jedoch von Hunden oder Wildtieren zerstört werden können. »Was wir am meisten hassen, sind Krebse«, sagt Epstein. »Mit ihren Scheren durchstechen sie manchmal die Membranen.«
Im Jahr 2016 wurde Epsteins damalige Studentin Brittany Berdy von einem Militärflugzeug zum Luftwaffenstützpunkt Thule an der Nordwestküste Grönlands mitgenommen, um dort nach einzigartigen Mikroben zu suchen, die an die extreme Umwelt angepasst sind. »Wir waren so weit im Norden, dass man nach Süden fahren musste, um die Nordlichter zu sehen«, erinnert sich Berdy, die jetzt am Broad Institute of MIT and Harvard in Cambridge, Massachusetts, studiert. Vor Ort watete sie ins kalte Wasser eines namenlosen Sees, um die iChips zu platzieren. Einige Wochen später kehrte sie zurück und sammelte sie wieder ein.
Zurück in Boston, versuchte Berdy, die Bedingungen des Sees mit verschiedenen Arten von Flüssigkeiten nachzuahmen. Der kniffligste Teil war jedoch die Temperatur des Sees von zehn Grad Celsius: zu kühl für ein Wasserbad, zu warm für einen Kühlraum. Schließlich verwendete das Team einen Kühlschrank in der wärmsten Einstellung und ließ die Tür leicht geöffnet.
Saccharibakterien aus dem Mund
Während sich Forscher wie Berdy, Epstein und Raoult von ihren angesetzten Kulturen überraschen lassen, suchen andere Forscher gezielt nach ganz bestimmtem Mikroorganismen: Mircea Podar, Mikrobiologe am Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, interessiert sich zum Beispiel für die großen und vielfältigen Saccharibakterien, früher bekannt als »TM7«. Sie gehören zu der Gesamtheit der Bakterien, die im menschlichen Mund lebt. Bis vor Kurzem konnten Saccharibakterien noch nicht im Labor kultiviert werden.
Im Jahr 1996 wurden die Saccharibakterien in einer Probe Torfmoor mittels Sequenzierung gefunden. Damit zählen sie zu den ersten Stämmen, die auf diese Art und Weise identifiziert werden konnten und nicht in einer Kultur im Labor. Die Bakterien kommen auch im menschlichen Darm, im Maul von Hunden, Katzen und Delfinen sowie in Böden, Sedimenten und Abwässern vor. »Sie sind sozusagen überall«, sagt Podar. Im oralen Mikrobiom des Menschen sind sie nicht besonders häufig, allerdings steigt oder sinkt ihre Anzahl bei bestimmten Krankheiten – darunter Parodontitis. Das deutet darauf hin, dass die Bakterien für unsere Gesundheit eine Rolle spielen.
Es war Anfang 2010, als Podar den Plan entwarf, wie sich die Saccharibakterien isolieren lassen könnten: Mit Hilfe des Genoms der Mikrobe, das aus der Einzelzellsequenzierung bereits bekannt war, wollte er vorhersagen, welche Proteine sich auf der Zelloberfläche befinden. Gegen künstliche Versionen dieser Proteine würden sich dann fluoreszierende Antikörper entwerfen lassen, mit denen die Mikroorganismen markiert werden könnten. Mit der so genannten Durchflusszytometrie sollte es schließlich möglich sein, sie aus einer Speichelprobe zu isolieren. Dem ersten Postdoc des Projekts, James Campbell, gelang es mit diesem Ansatz zwar, mehrere Kulturen anzusetzen, die bereits Saccharibakterien enthielten. Doch erst Jahre später, nachdem die Doktorandin Karissa Cross im Jahr 2014 das Projekt übernommen hatte, kam der Durchbruch. »Es war ziemlich knifflig, und in vielen Fällen fühlte es sich so an, als würde es niemals klappen«, erinnert sich Cross, heute Postdoc an der Vanderbilt University in Nashville, Tennessee. Sie versuchte es unter anderem in Flüssigkeiten, auf festen Oberflächen oder zum Beispiel auch mit Schokoladenagar, das sie etwa aus aufgelösten roten Blutkörperchen herstellte. »Es dauerte Tage, diese Dinge herzustellen.« Nichts funktionierte.
Dann, im Jahr 2015, kam der entscheidende Hinweis von anderen Forschern: Saccharibakterien können allein nicht überleben. Diese winzigen, kugelförmigen Bakterien mit einem Durchmesser von nur 200 bis 300 Nanometern benötigen einen Wirt aus dem Stamm der Actinobakterien. Bei dem Versuch, Saccharibakterien zu kultivieren, hatte Podars Gruppe diesen wichtigen Partner außer Acht gelassen. Im Sommer 2018 bekam Cross schließlich DNA-Sequenzen, die mit Saccharibakterien aus einer ihrer Kulturen übereinstimmten – und zwar nicht von irgendeinem Saccharibakterium, sondern wahrscheinlich von einer neuen Familie. Es sei ihr wichtigster Heureka-Moment ihres Studiums gewesen, sagt sie. Sie schickte Podar eine E-Mail: »Ich glaube, wir haben es geschafft.« Nur Sekunden später hörte sie Schritte im Flur. »High Five« – er kam zum Abklatschen.
Das richtige Rezept
Wenn es darum geht, solche wählerischen Mikroben zu füttern, kommt es auf Details an. »Ein All-you-can-eat-Büfett mit Aminosäuren und Zuckern, wie man sie in Standardrezepturen für Kulturmedien findet, ist nicht unbedingt der richtige Ansatz«, sagt Jörg Overmann, Mikrobiologe und wissenschaftlicher Leiter des Leibniz-Instituts DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) in Braunschweig. Ein Absenken der Nährstoffkonzentration hemmt etwa das Wachstum schnell wachsender Mikroben, so dass die langsam wachsenden Mikroben Zeit haben, sich zu vermehren.
Auch bestimmte Wachstumssubstrate können von Bedeutung sein. Overmanns Team lässt bisweilen ein Stück festes Material – zum Beispiel Stahl oder Glas – in eine Flüssigkultur baumeln, um ein Biofilmsubstrat bereitzustellen. »Auf diese Art und Weise bekommen wir ganz neue Sachen, die sich völlig von dem unterscheiden, was man auf einer Agarplatte bekommt«, sagt er. In einer Studie, bei der diese Technik mit Süßwasser- und Bodenproben angewandt wurde, hat das Team mehr als ein Dutzend noch nie zuvor gezüchtete Bakterienarten dingfest gemacht, darunter mindestens fünf neue Gattungen.
Yoichi Kamagatas Team in Japan wiederum verwendet spezielle Bioreaktoren, um einen Nährstofffluss aufrechtzuerhalten und Abfallstoffe zu entfernen. Wenn die Gesamtnährstoffkonzentration niedrig gehalten werde, spiegle dies etwa einen marinen Lebensraum besser wider, sagt er. Indem die Forscher einen Polyurethanschwamm – ähnlich einem Küchenschwamm – in einen Reaktor hängten, konnten sie zum ersten Mal ein Tiefseearchaeon aus der eukaryotenähnlichen Gruppe der Asgard-Archaeen kultivieren. (Anm. d. Red.: Archaeen, früher auch Urbakterien genannt, bilden neben den Bakterien und den Eukaryoten eine der drei Domänen zelullärer Lebewesen. Archaeen und Bakterien sind Prokaryoten, das heißt, sie besitzen im Gegensatz zu den Eukaryoten keinen Zellkern.)
Bakteriendatenbank
Hinweise, wo man mit der Suche anfangen könnte, finden Forscher in der so genannten BacDive-Datenbank (Bacterial Diversity Metadatabase). Hier sind die Merkmale und Kulturbedingungen für mehr als 80 000 Kulturen von 34 Bakterien- und drei Archaeenstämmen aufgelistet. Auch genetische Informationen – wenn sie denn verfügbar sind – könnten Hinweise liefern, sagt Christian Jogler, Mikrobiologe an der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Deutschland. Laut Jogler komme es manchmal auf Kleinigkeiten an: Anstatt sich auf Reinstwasser-Reinigungssysteme wie »Milli-Q« zu verlassen, wie sie in vielen Labors verwendet werden, stellt Joglers Gruppe ihr eigenes Reinwasser durch zweimaliges Destillieren her. »Milli-Q-Wasser kann Chemikalien enthalten, die das Wachstum einiger Kulturen behindern«, sagt er. Außerdem könnte auch das üblicherweise als Geliermittel verwendete Agar das Wachstum hemmen, weshalb Jogler manchmal Alternativen wie Gellangummi ausprobiert.
Auch die Art der Zubereitung des Agars kann wichtig sein, wie Kamagatas Gruppe zeigte: Wenn Agar zusammen mit Phosphaten durch Erhitzen entkeimt wird, entsteht dabei Wasserstoffperoxid, das das Wachstum einiger Mikroben verhindert. Die separate Sterilisation der einzelnen Komponenten beseitigte das Problem – und verhalf dem Team dazu, bislang unkultivierte Mikroben zu züchten. Und meistens gehört einfach auch viel Geduld dazu: Kamagata und seine Kollegen brauchten mehr als zwölf Jahre, um ihr Archäon wachsen zu lassen, das vorläufig Prometheoarchaeum syntrophicum getauft wurde.
Aber sobald Mikrobiologen die erste Kultur eines neuen Organismus angelegt haben, wächst diese Mikrobe normalerweise schneller. Epstein nennt diesen Prozess »Domestizierung«. Er vermutet, dass während des ersten, trägen Wachstumszyklus einige der Mikroben ihr Epigenom – die molekularen Marker auf der DNA, die die Genexpression kontrollieren – verändern, um sich an die Laborbedingungen anzupassen. Fortan wachsen sie schneller.
Auf in unbekannte Gefilde
Jetzt entwickelt Epstein eine Technologie, um neue Mikroben vollständig in situ zu isolieren und zu kultivieren. Er nennt die Geräte »Gullivers«, zu Ehren des Abenteurers in Jonathan Swifts Buch »Gullivers Reisen« aus dem Jahr 1726. Gullivers sind kleine, mit sterilem Gel gefüllte Kästchen mit einer halbdurchlässigen Membranoberfläche, in die Nährstoffe und Signalmoleküle diffundieren können, ähnlich wie beim iChip. Eine einzige Pore mit einem Durchmesser von einem Mikrometer erlaubt es einer Mikrobe aus der Umgebung einzudringen. Diese Mikrobe sollte dann den Eintrittsweg verstopfen, aber ihre Nachkommen könnten das Gel im Inneren der Box besiedeln und eine Kolonie bilden.

Schreiben Sie uns!